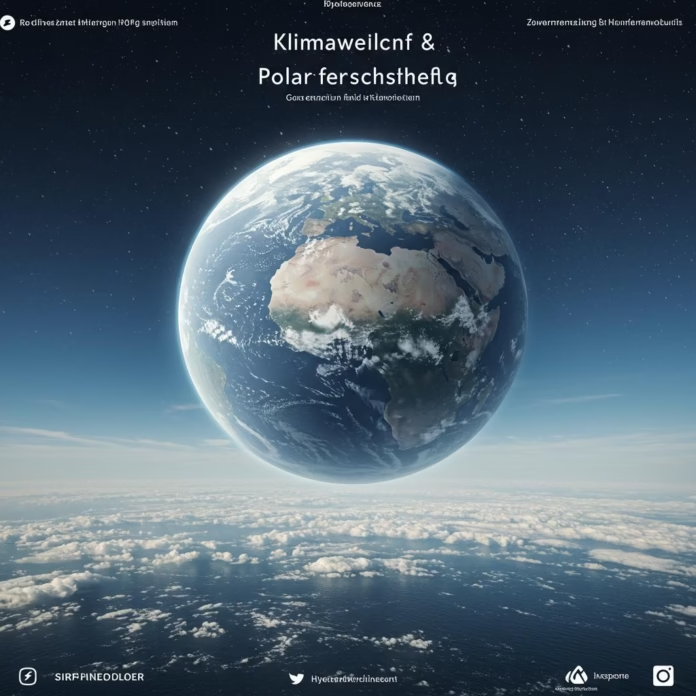Kollaps von A23a: Der zweitgrösste Eisberg der Welt zerfällt rapide
Im Südpolarmeer zerfällt einer der mächtigsten Eisberge der letzten Jahrzehnte: A23a. Neue Satellitenbilder und Analysen des British Antarctic Survey (BAS) zeigen eine zunehmende Fragmentierung dieses riesigen Eisberges in kleinere Teile.
Ursprünglich bedeckte A23a eine Fläche von rund 4000 Quadratkilometern – etwa viereinhalbmal so gross wie Berlin. Doch dieser Gigant existiert mittlerweile nur noch in Form zahlreicher Bruchstücke. In den letzten Wochen hat sich sein Zustand dramatisch verschlechtert.
Derzeit treibt A23a nordöstlich der Insel Südgeorgien im Südatlantik. Am vergangenen Wochenende zerbrach er erneut in mehrere grössere Fragmente. Laut dem BAS-Wissenschaftler Andrew Meijers „schreitet der Zerfall schnell voran“. Einige der losgelösten Eisstücke sind so gross, dass sie bereits als eigenständige Eisberge gelten.
Bis Ende August haben Forschende Fragmente von A23b bis A23f identifiziert. Es wird erwartet, dass sich der Zerfall mit dem anstehenden Frühling auf der Südhalbkugel noch beschleunigt. Von ehemals 4000 Quadratkilometern sind aktuell nur noch rund 1700 Quadratkilometer übrig.
Damit hat A23a seinen Platz an der Spitze verloren. Der neue grösste Eisberg der Welt ist D15A mit einer Fläche von 3000 Quadratkilometern – aktuell nahe einer australischen Forschungsstation verortet.
Ein Eisgigant mit langer Geschichte
Die Geschichte von A23a begann im Jahr 1986, als er vom Filchner-Ronne-Schelfeis abbrach. Kurze Zeit später setzte er sich auf dem Meeresboden fest – ein ungewöhnliches Verhalten für einen so grossen Koloss. Über Jahrzehnte verharrte er dort in kaltem Wasser, nahezu stabil und konserviert.
Erst im Jahr 2000 begann A23a sich zu lösen und driftete gemächlich durchs Südpolarmeer. Wie Daniela Jansen vom Alfred-Wegener-Institut erklärt: „Dass sich A23a praktisch direkt nach dem Abbruch wieder festsetzte, machte ihn über lange Zeit stabil – ein seltenes Phänomen bei Eisbergen dieser Grösse.“
Seit Anfang 2024 allerdings wanderte A23a in wärmere Gewässer nördlich des Weddellmeers. Dort liegen die Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt – die Abschmelzrate stieg drastisch. Inzwischen ist der Zerfall kaum noch zu stoppen.
Mögliche ökologische Folgen
Mit dem Abschmelzen von A23a verändert sich auch die marine Umwelt. Das kalte Schmelzwasser beeinflusst die Temperatur- und Nährstoffverteilung in den tieferen Wasserschichten – mit potenziellen Auswirkungen auf empfindliche Ökosysteme.
Geraint Tarling vom British Antarctic Survey warnt: „Ein plötzliches Einströmen von kaltem Schmelzwasser kann die Zusammensetzung der Wasserbewohner verändern. Das wirkt sich auf Nahrungsketten und auch die biologische Produktivität am Meeresboden aus.“
Der Fall A23a verdeutlicht exemplarisch die zunehmende Instabilität in den Polarregionen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird vom einstigen Riesen bald nur noch eine Ansammlung kleiner Eisschollen im Südatlantik übrig bleiben.
Fazit
Der Zerfall von A23a ist mehr als eine beeindruckende Naturbeobachtung – er ist ein mahnendes Signal für die weltweiten Klimaveränderungen. Während Einsteiger hier die Zerbrechlichkeit der Polarregionen erkennen, wird für Fachleute die Komplexität und Bedeutung polarer Systeme im globalen Kontext deutlich.