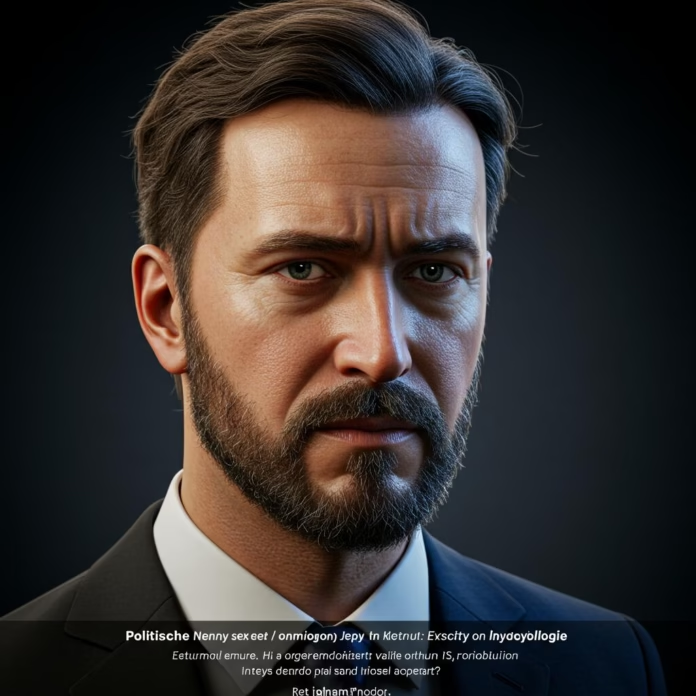Studie zeigt: Politische Extreme reagieren im Gehirn erstaunlich ähnlich
PROVIDENCE – Ob am linken oder rechten Rand des politischen Spektrums: Wer extrem denkt, zeigt im Gehirn überraschend ähnliche Reaktionen. Eine aktuelle Studie der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island, geleitet von der Psychologin Oriel FeldmanHall, bringt bemerkenswerte Parallelen in der neuronalen Aktivität bei politisch extremen Menschen ans Licht – unabhängig von ihrer ideologischen Ausrichtung.
Veröffentlicht im renommierten Journal of Personality and Social Psychology, betont die Studie die zentrale Rolle der Emotionen in der politischen Meinungsbildung. Besonders bei Menschen mit extremen Ansichten beeinflussen Gefühle stark, wie politische Informationen wahrgenommen und interpretiert werden.
So lief das Experiment ab
Die Studie umfasste 44 Teilnehmende, deren politische Einstellung anhand einer Skala von 0 (extrem liberal) bis 100 (extrem konservativ) erfasst wurde. Die Probandinnen und Probanden schauten zweimal ein 18-minütiges Video: einen Ausschnitt der Vizepräsidentschaftsdebatte 2016 zwischen Tim Kaine (Demokraten) und Mike Pence (Republikaner), in dem kontroverse Themen wie Einwanderung und Polizeireformen behandelt wurden.
Während des Betrachtens war ein Teil der Gruppe in einem MRT-Scanner, um neuronale Aktivitäten aufzuzeichnen. Außerdem wurde die Hautleitfähigkeit gemessen, ein Hinweis auf emotionale Erregung.
Gehirne reagieren bei Extremen besonders synchron
Die Auswertung ergab ein klares Muster: Menschen mit extremen politischen Überzeugungen zeigten signifikant ähnliche Gehirnaktivitäten – speziell in Arealen, die Emotionen wie Angst oder Bedrohung verarbeiten. Besonders bei hitzigen Debattenmomenten im Video wurde diese Synchronität deutlich.
Eine erhöhte körperliche Erregung verstärkte diese neuronalen Muster zusätzlich, was laut den Forschenden zu einer weiteren ideologischen Verfestigung führen kann.
Gemässigte denken differenzierter
Im Gegensatz dazu zeigten sich bei moderat politisch eingestellten Personen individuellere und weniger synchronisierte Gehirnreaktionen. Das deuten die Forschenden als Zeichen für eine kognitiv differenzierte Informationsverarbeitung, bei der emotionale Einfärbung weniger dominierend ist.
Studienleiterin FeldmanHall sagt: „Unsere Ergebnisse stützen in Teilen die sogenannte Hufeisentheorie.“ Diese Theorie besagt, dass sich politische Extreme – trotz ideologischer Gegensätze – psychologisch oft ähneln, was sich nun auch auf neurologischer Ebene zeigt. Entscheidender als die politische Richtung ist offenbar die Intensität der Überzeugung.
Co-Autorin Daantje de Bruin ergänzt: „Nicht nur, was jemand glaubt, ist wichtig, sondern auch, wie stark und emotional diese Überzeugung verankert ist. Das beeinflusst, wie politische Realitäten wahrgenommen und bewertet werden.“
Erkenntnisse mit Vorsicht übertragen
Die Studie basiert auf US-amerikanischen Daten. Ob die Ergebnisse auf Europa oder andere kulturelle Kontexte übertragbar sind, bleibt unklar. Dennoch liefert sie wichtige Hinweise für den gesellschaftlichen Umgang mit politischer Polarisierung.
- Menschen mit starker emotionaler Bindung an politische Themen bestätigen eher ihre eigene Weltsicht.
- Dies geschieht unabhängig von der politischen Ausrichtung – ob links oder rechts.
- Ein solches Verhalten kann Polarisierung verstärken, aber auch neue Wege zur Versöhnung aufzeigen.
Für Bildungswesen, Medien und politische Kommunikationsstrategien bedeutet das: Ein bewusster Umgang mit emotional aufgeladenen Inhalten ist essenziell. Nur so lassen sich Räume für konstruktive Debatten schaffen – ohne verhärtete Fronten zu verstärken.