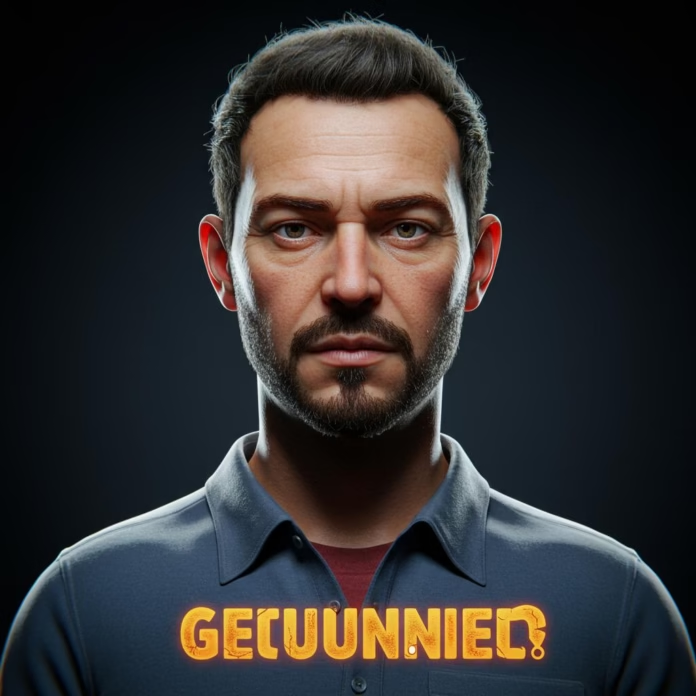Reiche setzen auf teure Blutwaesche gegen Mikroplastik – Trend erfasst die Schweiz
Zürich – Immer mehr vermögende Menschen in der Schweiz greifen auf sogenannte Blutwäschen zurück, um ihren Körper von Mikroplastik zu reinigen. Die Methode, bekannt als Apherese, hat sich ursprünglich bei Autoimmunkrankheiten bewährt – doch nun erlebt sie ein Comeback als Detox-Trend, obwohl der wissenschaftliche Nutzen in diesem Zusammenhang noch nicht eindeutig bewiesen ist.
Der Trend erhält Aufwind durch prominente Vorbilder wie Schauspieler Orlando Bloom, der nach eigenen Angaben rund 13’000 US-Dollar für solche Behandlungen zahlte. Auch Größen aus der Tech-Industrie wie Mark Zuckerberg oder Biohacking-Verfechter Bryan Johnson sollen sich dieser Methode bedienen. Nun erreicht der Promi-Trend auch Europa – insbesondere die Schweiz.
Was ist Mikroplastik und wie gelangt es in den Körper?
Mikroplastik bezeichnet feste Kunststoffpartikel, die kleiner als fünf Millimeter sind. Diese unsichtbare Umweltbelastung hat längst ihren Weg in den menschlichen Organismus gefunden. Die Quellen sind vielfältig:
- Trinkwasser
- Verarbeitete Lebensmittel
- Kosmetika
- Die Luft
Studien belegen, dass Mikroplastik bereits in menschlichem Stuhl, aber auch in inneren Organen wie Lungen, Nieren, Lebern und sogar in Spermien gefunden wurde.
Man unterscheidet zwischen:
- Primärem Mikroplastik: Wird gezielt in Produkten wie Peelings oder Waschmitteln verwendet.
- Sekundärem Mikroplastik: Entsteht durch Zerfall größerer Kunststoffobjekte wie Flaschen oder Verpackungen.
Apherese: Altbekannte Technik mit neuem Image
Die Apherese ist ein seit Jahrzehnten genutztes medizinisches Verfahren, das vor allem bei schweren Erkrankungen wie Lupus oder anderen Autoimmunkrankheiten verwendet wird. Dabei wird das Blutplasma maschinell gereinigt. Heute wirbt man damit, auch Mikroplastikpartikel damit entfernen zu können – auch wenn es dafür bislang keine eindeutigen Wirknachweise gibt.
Alexander Sahmel, Arzt und CEO des «Swiss Center for Health & Longevity» in Zollikon bei Zürich, beschreibt eine stark gestiegene Nachfrage bei seiner wohlhabenden Klientel. „Etwa die Hälfte unserer Patienten kommt nicht aus medizinischer Notwendigkeit, sondern zur präventiven Entgiftung“, sagt er. Die Kosten: Zwischen 8000 und 10’000 Franken für zwei Behandlungen inklusive Analyse.
Risiko: Plastik durch Plastik?
Kritiker äußern Bedenken, ob bei einer Blutwäsche mit Plastikfiltern nicht sogar neues Mikroplastik in den Körper gelangen könnte. Sahmel hingegen versichert, dass in seiner Klinik nur geprüfte und hochwertige Materialien verwendet werden. Zudem würden spezielle Filter eingesetzt, um Rückverunreinigungen zu verhindern.
Blutproben zeigen nach der zweiten Behandlung laut Klinikangaben bis zu 50 Prozent weniger nachweisbares Mikroplastik im Blut. Doch wie viel Mikroplastik zuvor tatsächlich im Körper war, lässt sich noch nicht verlässlich bestimmen – es fehlen internationale Standards zur Messung.
Ein Fortschritt oder doch nur Luxus-Placebo?
Die Idee, Mikroplastik durch Apherese aus dem Körper zu entfernen, ist umstritten. Manche sehen darin einen innovativen Ansatz der Gesundheitsvorsorge, andere ein teures Placebo ohne wissenschaftliche Grundlage. Während erste Hinweise auf eine gleichzeitige Reduktion von Schwermetallen und Toxinen existieren, bleiben medizinische Empfehlungen bisher aus.
Trotz fehlender Nachweise boomt das Geschäft: Für viele Kunden reicht allein der subjektive Effekt der „Entgiftung“, um tausende Franken in die Behandlung zu investieren – ganz ohne Diagnose.
Fazit: Exklusive Körperpflege trifft Umweltangst
Ohne fundierte medizinische Studien bleibt die Mikroplastik-Apherese eine faszinierende, wenn auch umstrittene Selbstoptimierungs-Methode. Für viele reiche und gesundheitsbewusste Patienten ist sie Ausdruck des Wunsches, Kontrolle über unsichtbare Risiken wie Umweltgifte zu gewinnen – oder zumindest das Gefühl davon.
Eines ist sicher: Die Debatte um Mikroplastik wird bleiben. Mit wachsender Sensibilisierung für Umwelt- und Gesundheitsfragen könnten Behandlungen wie diese weiter an Beliebtheit gewinnen. Für Privatkliniken ist das eine lukrative Zukunftsperspektive jenseits klassischer Medizin.