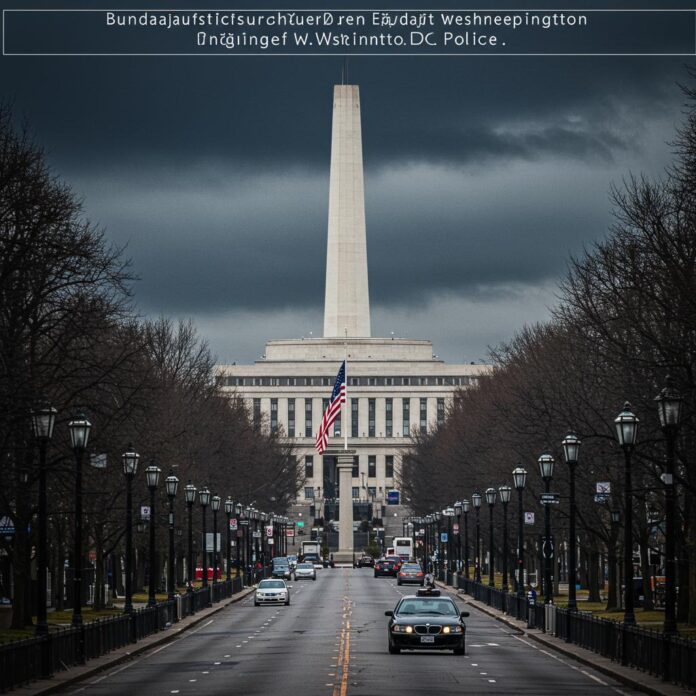Trump etabliert Bundesaufsicht über Polizei in Washington D.C.
In einem bisher beispiellosen Schritt hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Kontrolle über die Polizei von Washington D.C. zentralisiert. Der Leiter der US-Drogenvollzugsbehörde (DEA), Terry Cole, wurde als sogenannter „Notfall-Polizeipräsident“ eingesetzt. Damit steht der gesamte Sicherheitsapparat der Hauptstadt nun direkt unter Bundesaufsicht – ein Novum in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Vollständige Entmachtung der lokalen Polizei
US-Justizministerin Pam Bondi verkündete, dass Cole ab sofort sämtliche Befugnisse der bisherigen Polizeichefin Pamela Smith übernimmt. Alle neuen Maßnahmen des Metropolitan Police Department (MPD) müssen nun von ihm genehmigt werden. Dies bedeutet faktisch das Ende der lokalen Selbstverwaltung im Bereich der öffentlichen Sicherheit in Washington D.C.
Diese Entscheidung wird mit einer angeblich zunehmenden Kriminalitätslage begründet. Tatsächlich zeigen offizielle Statistiken aber sinkende Kriminalitätsraten. Viele Beobachterinnen und Beobachter werfen Trump daher politische Inszenierung vor, insbesondere im Hinblick auf seine Wiederwahlambitionen.
Empörung unter den Bürgerinnen und Bürgern
Ein Bürger äußerte stellvertretend die Sorge vieler Einwohnerinnen und Einwohner: „Das fühlt sich an wie ein stiller Putsch gegen unsere gewählte Stadtregierung.“ Die zunehmende Kontrolle des Weißen Hauses über lokale Institutionen sorgt für verfassungsrechtliche Bedenken und ruft wachsenden Protest hervor.
Modell für andere Städte?
Trump selbst sieht das Vorgehen als Modell mit Vorbildfunktion:
„Das Modell, das wir in Washington einsetzen, könnten wir in anderen Städten genauso anwenden.“
Zwar sei laut Gesetz eine Begrenzung auf 30 Tage vorgesehen, doch könne diese durch Notstandsregelungen verlängert werden – eine rechtliche Grauzone, vor der viele Juristinnen und Juristen warnen.
Zusätzlich kündigte Trump exklusive Gesetzesinitiativen für Washington an, welche später auch landesweit umgesetzt werden könnten. Dem Wunsch nach einem Bundesstaatenstatus für Washington D.C. erteilte Trump eine klare Absage: „Wir schaffen hier Ordnung – das wird kein Bundesstaat.“
Kulturelle Kontrolle über Museen
Trump greift nicht nur in den Sicherheitsapparat ein, sondern auch in die Kulturpolitik. Die Smithsonian Institution, Dachverband der großen Museen der Hauptstadt, muss künftig alle Ausstellungen, Katalogtexte und Wandbeschriftungen staatlich prüfen lassen.
Zweck sei es laut Weißem Haus, „die amerikanische Geschichte korrekt darzustellen“. Kritikerinnen und Kritiker sehen darin jedoch einen autoritären Eingriff in die wissenschaftliche und kulturelle Unabhängigkeit. Historikerinnen sprechen von einem gezielten Kulturkampf unter dem Deckmantel nationaler Identität.
Demokratische Grundordnung unter Druck
Trumps Maßnahmen stellen die föderale Ordnung der USA infrage. Die Hauptstadt direkt durch Bundesbehörden verwalten zu lassen, könnte verfassungsrechtlich höchst bedenklich sein. Dennoch setzt der Schritt einen Präzedenzfall, der die demokratischen Prinzipien der Vereinigten Staaten ins Wanken bringt.
In einer Phase angespannter innen- und außenpolitischer Lage nutzt Trump diese Bundesaufsicht als Machtdemonstration – sowohl gegenüber politischen Gegnern im eigenen Land als auch im internationalen Kontext.
Wie geht es weiter?
Ob Trumps Maßnahmen bestehen bleiben, hängt nun maßgeblich vom US-Kongress ab, wo sich zunehmend Widerstand formiert – auch innerhalb der republikanischen Partei.
Fest steht: Der direkte Zugriff auf Washington D.C. durch die Bundesregierung ist ein beispielloses Signal. Es geht um mehr als nur Sicherheit oder Ordnung – es geht um Macht, Kontrolle und um die Zukunft der amerikanischen Demokratie.